ESSAY: Offene Weite – nichts von heilig

Religion, so heißt es, sei die Verhinderung von religiöser Erfahrung. Der Satz entstammt der modernen Tiefenpsychologie und ist selbst eingebettet in religiöse Entwicklungen beziehungsweise die Entwicklung von Religion in der europäischen Neuzeit. Ob er so allgemein wahr ist, sei dahingestellt. Aber er wirft Licht auf ein Problem: unser Verhältnis zur Tradition. Der evangelische Theologe, Zen- und Yoga-Lehrer Michael von Brück über seine religiöse Zweisprachigkeit als Christ und Zen-Praktizierender.
Tradition ist, wie alles im Leben, ambivalent, das heißt zweideutig. Einerseits bewahrt und überträgt sie kulturelles Wissen über die Zeiten hinweg, damit es angeeignet werden kann und das Rad nicht in jeder Generation neu erfunden werden muss. Andererseits prägt Tradition Vorurteile, sie lenkt die Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung und schließt andere Möglichkeiten aus, sie zurrt unsere Gedanken und Empfindungen fest, das heißt, sie ist wie eine Brille, die wir aufgesetzt haben, um zu sehen. Aber sie lässt uns nur sehen, was im Fokus der Brille zu sehen möglich ist. Traditionen der Sprache, des Denkens, der Kunst, der Religion – sie sind wie Fenster auf die Wirklichkeit: Wir sehen nur, was in diesem bestimmten Fenster erscheint. Doch es gibt andere Fenster, die Wirklichkeit anders sehen, erkennen und genießen lassen. Tradition, also Religion, ermöglicht und verhindert zugleich.
Götzen unserer Begriffe und Werturteile
Diese Einsicht ist nicht neu, und wir könnten es dabei bewenden lassen, wenn nicht Menschen dazu tendierten, ihre je eigene Sicht auf die Dinge absolut zu setzen und damit für allein gültig zu erklären oder – mit einem Wort aus der Religion selbst – aus ihrer jeweiligen Sicht einen Götzen zu machen. Nicht nur die Götzen aus Holz, Stein und Metall sind das Problem, sondern vor allem die Götzen unserer Begriffe und Werturteile. Menschen tun dies, besonders auch im Zusammenhang mit Religion, aus zwei Gründen: aus Unsicherheit und aus Machtstreben. Erstens aus Unsicherheit, weil tief im Unterbewussten oder manchmal auch halb bewusst klar ist, dass meine eigene Sicht der Dinge so ganz überzeugend nicht ist, also muss ich mich ihrer vergewissern, indem ich mir das Argument der Zahl vorspiegele: Was alle glauben, wird schon richtig sein. Als ob Wahrheit etwas mit Mehrheiten zu tun hätte. Der eigene Zweifel wird dadurch übertönt: Dogmatismus aus Schwäche und Selbstzweifel also. Zweitens aus Machtstreben, weil Uniformität Macht über die Uniformierten bedeutet. Das trifft auf Kleidungszwänge, Verhaltenszwänge und Denkzwänge in gleicher Weise zu.
Religion hat es immer mit Macht zu tun, denn im Ritual und den Erzählungen und Deutungen von Welt vergegenwärtigt sie Ordnungen, die Übersicht ermöglichen. Übersicht entsteht in Hierarchien des Himmels und der Erde. Religion also repräsentiert und reflektiert, wie die Machtverhältnisse sind, die vom Menschen beachtet werden müssen, damit er nicht Schaden nehme. Die alten Götter waren meist mächtig, aber unberechenbar, so jedenfalls bei den Griechen und Indern. Man musste sie durch Opfer und allerlei Gaben gnädig stimmen. Später, zu Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus, wurde in Mesopotamien, Indien und anderswo das kodifizierbare Recht entdeckt. Nicht Willkür und Zufall, sondern Recht und Notwendigkeit sollten nun den Lauf der Welt bestimmen. Die Götter verbürgten das Recht, das sie selbst setzten und an das sie sich halten würden. Dem, der sich an das Recht hielte, würde ebenfalls Recht widerfahren. Doch schon die Ijobsgeschichte zeigt, dass dem nach menschlicher Erfahrung nicht so ist. Der rechtlose Machtmensch scheint zu triumphieren, und der Fromme hat das Nachsehen, ja, er muss schrecklich leiden. Gott antwortet Ijob nicht mit einem Argument, sondern mit einer Machtdemonstration: „Wer bist du, dass du anklagst, warst du etwa dabei, als ich die Welt erschuf?“ „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir“, tönt es Jahrtausende später in Goethes Faust, gesprochen zu dem zweifelnden Faust, gedonnert vom Erdgeist, dem der Mensch ausgesetzt ist, den er aber nicht zu fassen vermag.

Am Anfang eine tiefe Erfahrung von Geborgenheit
Doch der Mensch will es fassen, will begreifen, um zufrieden zu sein. So entwickelten sich die „Erlösungsreligionen“ – Buddhismus, Christentum, viele Formen des Hinduismus, Islam, auch das rabbinische Judentum und viele andere mehr. Da war am Anfang eine tiefe Erfahrung von Geborgenheit, die nicht aus menschlichem Willen und Denken kam, sondern die alles Fragen und Zweifeln zerschmetterte, nicht durch Macht, sondern durch Liebe: Das unbegreifliche Mysterium selbst gibt sich hin, macht sich dem Menschen heimisch. Einige nennen es Gott, andere nicht. Entscheidend war hier: Nicht die Opferrituale und Rechtsnormen halten die Welt zusammen, sondern die befreiende Liebe, die aus dem Grund der Wirklichkeit selbst kommt.
Als Christen reden wir grundlegend von der Liebe: „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1 Johannes 4,16). Liebe, heißt das, ist nicht bloß ein Gefühl, ist keine vorübergehende Laune des Schicksals, sondern die Grundstruktur der Wirklichkeit selbst: dass alles, wie es ist, letztlich in einem großen Zusammenhang aufgehoben ist, eins in allem und alles in einem. Durch Zen ist mir zur Erfahrung geworden: Man kann kaum lieben wollen, schon gleich gar nicht lieben sollen. Sondern Liebe geschieht – und erst davon abhängig ist überhaupt etwas: die Erde, die Natur, wir Menschen. Nicht, dass erst einzelne „Dinge“ da wären, die dann nachträglich Beziehungen eingingen – und das nennen wir dann, wo Erkenntnis und Emotionen im Spiel sind, Liebe. Nein, alles, was ist, verdankt sich dem Geschehen der Liebe.
Dies ist der Grund der Wirklichkeit. Alles, was ist, ist sekundär, davon abgeleitet. Liebe ist wie ein Strom von Energie, der ein Beziehungsnetz aufspannt, und in diesem Strom gegenseitiger Abhängigkeit entsteht, was wir als Wirklichkeit erleben. Im Zen erfährt man diesen Strom jenseits einzelner Vorstellungen, Bilder, Gegenstände. Es ist etwas tief am Boden des Bewusstseins, und dieser offene Raum schwingt in allem mit, was ist. Die Konzentration muss nur ganz fein werden, sodass sich alle Gegensätze vereinen – und dann wird dieser Raum, dieser Klang vor jedem Klang, der Ton, der da ist, bevor es einatmet, der Geist, der alles umfasst, spürbar. In verschiedenen Sprachen, Bildern, Erzählungen und Begriffen haben die Religionen diese Grunderfahrung ganz unterschiedlich ausgedrückt und daraus Traditionen geformt. Eben, Traditionen. Und hier gilt: Traditionen ermöglichen und verhindern.
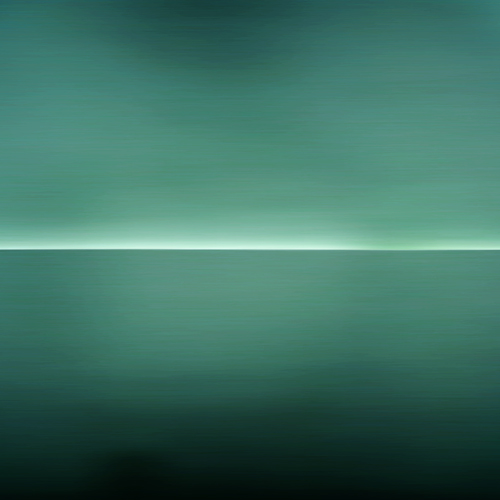
Freiwerden von Vorurteilen
Was aber meine ich, wenn ich „Zen“ sage? Zen ist die Tradition, die besonders sensibel dafür ist, dass jede Brille nur eine Brille ist und immer wieder abgesetzt werden muss, damit wir neu sehen können. Zen behauptet dies nicht nur, sondern lehrt eine Methode, wie das geschehen kann, ohne dass der Mensch im geistigen Chaos endet. Ganz im Gegenteil: Zen befreit zu einer Freiheit von Worten, Begriffen, Bildern, Ritualen und so weiter. Und just diese Freiheit erlaubt es, ganz neu und ohne jedes Vorurteil die Rituale des Lebendigseins neu zu zelebrieren. Was heißt das?
Zen kann man beschreiben als die systematische Lebensübung, von Vorurteilen frei zu werden. Weil jedes Urteil hinterfragt, analysiert und zersetzt wird. Nicht mit logischen Argumenten, wie die Philosophie es tut, sondern mit einer existenziellen Übung des Körpers und des Atmens, wo sich der Mensch seiner tiefen Einheit mit allem bewusst wird. Ich erfahre, dass das, was mir als „Gegensatz“ erscheint, in Wirklichkeit die Kehrseite der Medaille ist. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn alle unsere Gewohnheiten der Wahrnehmung, des Fühlens, des Denkens, des Urteilens und des Handelns sind davon betroffen. Zen richtet die geballte Aufmerksamkeit nicht auf irgendwelche Objekte des Bewusstseins – Begriffe, Bilder, Vorstellungen, und seien sie noch so hehr und heilig –, sondern auf die Wurzel aller geistigen Prozesse selbst. Dadurch relativieren sich nicht nur die Bilder und Gedanken, sie bekommen auch neues Leben.
„Denke das Nicht-Denken“
Zen führt ein in eine Tiefenerfahrung des Geistes, die auch als „Leerheit“ beschrieben wird. Was ist damit gemeint? Der Zen-Übende lässt die Gedanken vorüberziehen und verweilt nicht bei ihnen, er hält sie vor allem nicht für Abbilder der Wirklichkeit. Gedanken sind vielmehr Produkte des Bewusstseins, und Begriffsbilder sowie Konzepte entstehen, wenn Sinneseindrücke zusammengefasst und vom Bewusstsein in wieder erkennbaren Mustern verarbeitet werden. Sie repräsentieren Teilbereiche des Wahrgenommen in einer Gestaltgebung (Begriffe), die vom Bewusstsein selbst hervorgebracht wird. Das Problem wird nun nicht nur im Zen, sondern in fast allen Schulen des Buddhismus darin gesehen, dass der Mensch diese Begriffsbildungen für das Wirkliche hält und damit die Dinge verfälscht wahrnimmt, nämlich getrennt, also in Dualitäten aufgespalten durch Urteile, die zu Einseitigkeiten und Verstrickungen führen. Begriffe sind zwar notwendig, um die Vielfalt der Sinneseindrücke zu filtern und zu ordnen, doch sie repräsentieren nicht das, „was ist“, sondern erzeugen Stereotype und Projektionen, und die Wirklichkeit erscheint in Rastern des Gewohnten, Vergangenen und stereotyp Geordneten. Vor allem aber verhindern feste Vorstellungen („fixe Ideen“) die Offenheit für das Gegenwärtige und spontan Neue in jedem Augenblick.
Die Zen-Übung bewirkt nun, dass das Bewusstsein frei werden kann, indem das Aufnehmen und Verarbeiten ständig neuer Sinneseindrücke unterbunden wird. Stattdessen konzentriert sich das Bewusstsein auf sich selbst, das heißt auf einen in ihm selbst wirkenden Strom von achtsamem Gewahrsein. Im Zen gilt: Auch alle Begriffe und Vorstellungen des Zen müssen letztlich fallengelassen werden. Das Ziel des Zen besteht also im Nicht-Anhaften an Gedanken, Gefühlen, Handlungen. Nicht-Anhaften auch am Zen! Diese Haltung teilt das Zen mit allen anderen Formen des Buddhismus. Die berühmte Formulierung des japanischen Zen-Meisters Hakuin (1686–1769), „Denke das Nicht-Denken“, meint eine klare Bewusstheit und Aufmerksamkeit, die in sich selbst stabilisiert ist, ohne dass die Aufmerksamkeit einen Gegenstand des Denkens dabei festhielte und sich durch dieses Festhalten stabilisieren würde. „Nicht-Denken“ ist nicht die Abwesenheit von Gedanken – denn das wäre nur der Gegensatz zu Gedanken und bliebe auf der Ebene der Dualität –, sondern ein Zustand frei von der Dualität von Ja und Nein, der freie Fluss des Bewusstseinsstromes ohne Bewertungen, die das eine ergreifen, das andere aber verneinen würden.
Zen ist eine Übung des Schweigens – dabei schweigt nicht nur der Mund, sondern vor allem der Geist, das heißt die Gedanken, Emotionen und Bewertungen jeglicher Art. Das ist nur möglich, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Dieses Schweigen ist sicherlich ein Rückzug in die ganz elementaren Prozesse des Lebens – Rückzug auf den Atem und ein Spüren in das hinein, was dem Atem zugrunde liegt, ein Schweigen, das ganz subtile Bewegung ist, ein Ur-Klang, den man nicht mit dem äußeren Ohr hört, wohl aber mit dem inneren. Es ist der Raum, aus dem alle Bilder, Hoffnungen, Erwartungen aufsteigen. Wenn man mit diesem Raum in Berührung kommt, dann ist man an der Wurzel dessen, was religiöse Sprache in verschiedenen Worten ausdrückt: Gott, Geist, Tiefenbewusstsein, Buddha-Natur, Logos. Ich wiederhole: Diese Sprachen sind unterschiedlich, und sie erzeugen unterschiedliche Vorstellungen und Lebensweisen. Die Religionen sind nicht gleich. Aber alles wurzelt in einer tieferen Dimension, in der alles zu einer großen Einheit kommt, nein: Aus dieser großen Einheit kommt alles, was wir in unserer Erfahrungswelt differenziert wahrnehmen.

Der Zen-Weg führt in die Voraussetzungslosigkeit
Der amerikanische Trappistenmönch Thomas Merton hat darum auch darauf hingewiesen, dass das kontemplative Schweigen zwar eine Einsamkeit bedeutet, die allerdings nicht zur Vereinzelung und Abkapselung führt. Der schweigende Mensch ist mit allen verbunden. Dies ist die ursprüngliche Erfahrung der Liebe, die mehr als ein Gefühl ist. Sie ist die Kraft des Seins selbst. Liebe kennt kein „Du sollst“. Sie ist der Ausdruck des „Du bist“. Du bist was? Ein Echo der einen unfasslichen göttlichen Wirklichkeit, der Ausdruck eines unmittelbaren Willens zum Leben. Ich lebe mein Leben in „Gott“, und alle anderen Wesen leben in gleicher Weise. Dies wird in der tiefen Zen-Erfahrung ganz unmittelbar bewusst. Die Folge davon ist, dass alles, jedes Lebewesen, jeder Mensch unendlich kostbar wird – wir können gar nicht anders, als allem in einer tiefen „Ehrfurcht vor dem Leben“ zu begegnen. Dies ist die „ethische Mystik“ oder „mystische Ethik“, wie sie Albert Schweitzer zu leben versuchte. Sie folgt nicht aus logischem Schlussfolgern, sondern aus einem voraussetzungslosen Lebensimpuls. Der Zen-Weg führt in diese Voraussetzungslosigkeit. Er schaut hinter jeden kulturellen und religiösen Firnis und stellt sich dem Erlebnis unmittelbarer Seinskraft in der Tiefe des Geistes, bevor das Bewusstsein Begriffe gebildet und damit die Wirklichkeit aufgespalten hat.
Zen öffnet den Menschen, diese Einheit zu sehen. Die christliche Tradition hat diese Einheit im Bild vom „mystischen Leib Christi“ erahnt, und Jesus selbst hat mit seiner Rede vom Weinstock genau in diese Richtung gewiesen. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ (Johannes 15,5), das heißt doch, dass alle Wesen von dem einen göttlichen Lebenssaft durch ossen sind. Christen spüren dies in der innigen Verbindung im Geist Jesu. Menschen in anderen Traditionen nennen das in ihren Sprachen anders. Aber die tiefe Erfahrung dieser Einheit, das ist es eigentlich, was mir durch Zen aufgeleuchtet ist, und woraus ich jeden Augenblick zu leben versuche. Dann fällt es wie Schuppen von den Augen, und ich lese viele Texte der griechischen Bibel in einem neuen Licht.
Personalität als Verbundenheit
Ist die christliche Gottesvorstellung nicht personal, während doch Zen einen personalen Gott ablehnt? Erstens lehnt Zen keinen personalen Gott ab, sondern weist darauf hin, dass jede Gottesvorstellung – ob personal oder transpersonal – Projektion eines anhaftenden Bewusstseins ist. Und zweitens: Was soll denn das Wort personal bedeuten? Auch die christliche Tradition weiß spätestens seit Augustinus, dass „Personalität“ eine missverständliche Metapher für Gott ist. Machen wir es kurz: Wir können die Welt und den Grund der Welt, das Geheimnis ihres Seins, nur in anthropomorphen Bildern beschreiben, wie sie unserem Bewusstsein zur Verfügung stehen. Auch abstrakte Begriffe wurzeln in Vorstellungen, und ihre Abstraktion ändert nichts daran, dass sie menschliche Erkenntnisbedingungen widerspiegeln und nie die Sache an sich bedeuten können, wie Immanuel Kant ausgeführt hat. „Person“ ist das höchste Gut, das wir an uns selbst erleben. Person bedeutet, dass wir sind, was wir sind, in Beziehung zu Anderen. Wir sind in Abhängigkeit von unseren Eltern, Großeltern und so weiter, in Abhängigkeit von allen anderen Menschen in der Gesellschaft, die leben und arbeiten und damit unsere eigene Lebensgrundlage ermöglichen: Lehrer, Bäcker, Bauern, Elektrizitätswerker, Busfahrer und so weiter. Person bin ich in diesen Beziehungen.
Der Buddhismus spricht von Nicht-Ich, denn er lehnt eine unteilbare unveränderliche Substanz, die „Ich“ wäre, ab. Dies ist nicht nur Theorie, sondern eine ziemlich einleuchtende Umschreibung dessen, was der Übende im Zen erfährt. Personalität aber ist nicht Individualität. Der Begriff des Individuums ist ohnehin schwierig. Er bedeutet: „das Unteilbare“. Aber bin „ich“ unteilbar? Indem „ich“ mich spüre, wahrnehme, erkenne, trete ich mir doch selbst gegenüber: „Ich“ erkenne „mich“, das heißt, ich werde mir selbst zum Gegenstand der Erkenntnis. Damit bin ich aber ein „Dividuum“, ein Geteiltes. Wir könnten lange darüber philosophieren, was dies bedeutet. Erkenntnistheoretisch ist das Problem nicht neu: Kant, Schopenhauer, Nietzsche – sie alle haben das Thema auf verschiedene Weise erörtert. Ein naiv empfundenes Ich verschwindet, wenn man die Dinge analysiert. „Ich“ denken, fühlen, wahrnehmen, erfahren ist keine Individualität. Ja, „ich“ denke überhaupt nicht, sondern da ist das Denken, und das erzeugt neben Gedanken und Gedankenverbindungen auch das Subjekt des Denkens, eben „Ich“. Aber zuerst ist das Denken, Fühlen, das Ich ist abgeleitet.

Alles enthalten, alles aufeinander bezogen
Hinter dem Denken und Fühlen und Wahrnehmen kann das Bewusstsein – und das geschieht in der Zen-Praxis – in einen Grund sinken, in eine reine Aufmerksamkeit, in der die Gegensätze verschmelzen und nur noch „Gewahrsein“ übrig bleibt. In diesem Gewahrsein ist alles enthalten, alles aufeinander bezogen. Es ist ein Raum von Personalität, gegenseitiger Beziehung. Ich gebrauche gern folgendes Bild: Ein Pilzsammler geht durch den Wald und erblickt verschiedene Pilze: Der eine ist alt, der andere jung, der eine verdorrt, der andere frisch, einer krumm, der andere gerade, einer angefressen, der andere mit makellos rundem Hut. Dies scheinen individuelle Pilze zu sein mit ihrer je eigenen „Biografie“. Aber das scheint nur so, denn die Pilzwurzel (das Myzel) ist unter der Erde, wie jeder Pilzkundige weiß. Die Pilze über der Oberfläche sind die Fruchtkörper ein und desselben Pilzes – es ist ein großer Zusammenhang. Zen bedeutet, vom naiven Pilzsucher zum Mykologen zu werden, der hinter die Oberfläche schaut und die Einheit im Wurzelgrund wahrnimmt. Personalität also ist die Einheit in der Verbundenheit mit allem anderen, wobei das je Besondere, das durch die eigene Biografie entsteht, dabei nicht verloren geht. Personalität ist die Einheit im Ganzen, die jeden besonderen Augenblick des Lebens und jede besondere Gestaltung durchdringt, wie der Geschmack eines Gewürzes verschiedene Speisen durchdringt, ohne dass die Verschiedenheit dabei verloren gehen würde. Oder wie ein Orgelpunkt, der die Melodien und Harmonien, die über ihm erklingen, durchdringt und in eine völlig einigende Beziehung setzt, ohne dass jene Einheit die Verschiedenheit und Besonderheit des Augenblicks der Tongebung beziehungsweise der polyfonen Figur aufheben würde.
Dies sind Bilder, Vergleiche, die ganz unzulänglich sind, aber vielleicht die Richtung andeuten. Jedenfalls ist jede Zen-Erfahrung besonders, unverwechselbar, und doch ist es immer „derselbe eine Geschmack“. In christlich geprägter Sprache bedeutet dies für mich: Gott ist nicht ferne, sondern in jedem von uns sowie in jedem Augenblick in besonderer Weise gegenwärtig, und er bleibt dabei doch der eine unteilbare Gott. Wach für diese innerste Verbundenheit zu sein heißt Personalität.
Liebe und das Böse
Ist nun nicht das Besondere des Christlichen die Liebe, die so im Buddhismus nicht zur Sprache kommt? Gewiss, die Sprachen sind verschieden, so auch die psycho-sozialen Muster. Doch Vorsicht: Es gibt auch in Bezug auf diese Frage weder den Buddhismus noch das Christentum. Beide haben sich in der Geschichte erheblich verändert und werden sich weiter verändern. Aber was ist denn Liebe? Ich hatte oben schon angedeutet: Liebe ist nicht die Verbindung von zunächst unabhängigen Wesen, sondern Liebe ist die Grundlage, das Verbundensein, das Netz eines Beziehungsgeflechtes, aus dem erst die Wirklichkeit einzelner Erscheinungen entsteht – angefangen von Atomen bis zu menschlichen Wesen. Liebe ist die Grundstruktur der Wirklichkeit. Im Zen kann man das leibhaftig erfahren, und dies ist wie eine Auferstehung aus der Dualität, aus der Getrenntheit und Fragmentierung, aus der Trennung von Gott, die ja das Christentum Sünde nennt.
In Christus schauen wir diese Überwindung, diese leibhaftige Auferstehung, in einzigartiger Weise schon an, er ist der Prototyp und Maßstab für jede menschliche Entwicklung. Der Buddha ist ein anderes, wiederum einzigartiges Modell. Verschieden sind beide, aber nicht einander ausschließend, weil tiefe Wahrheiten, die mehr sind als die Behauptung von Sätzen, obwohl verschieden, dabei nicht widersprüchlich sein müssen. Christus will allerdings hier und jetzt geboren werden, ebenso sind sein Tod und seine Auferstehung die entscheidenden Ereignisse, die das Leben eines jeden Menschen jetzt zur Reifung führen. Das freilich hatte schon Meister Eckhart erkannt. Zen ist die genaue Übung, wie der Mensch als Einheit von Leib-Atem-Geist sich so vorbereiten kann, dass diese Verwandlung Gestalt gewinnt – bei jedem Menschen anders, und doch ist es immer dasselbe.

Zwei Seiten einer Medaille
Hier meldet sich ein Einwand, bewusst oder unbewusst sträubt sich die Lebenserfahrung bei so viel Harmonie und Einheit: Gibt es nicht das Böse, das schreckliche Leiden, die Niedertracht und Verzweiflung? Der sorgsame und schonungslos ehrliche Umgang mit dieser Frage führt zum Kern jeder Spiritualität, die diesen Namen verdient. Wir müssen unterscheiden: Es gibt Leiden, das aus der Vergänglichkeit (Sterben und Tod) sowie Veränderlichkeit der Natur (Naturkatastrophen) kommt. Kampf und Ausgleich der Gegensätze, auch im menschlichen Geist, sind eine Folge davon. Leben und Sterben sind zwei Seiten einer Medaille, das Vergehen und Neuwerden ist der Prozess des Lebens. Der Mensch hat die Intelligenz, sich darauf einzurichten, denn in jedem Abschied liegt ein Anfang.
Wir leiden trotz der Einsicht, aber es ist möglich, dieses Leiden so zu erfahren, dass es in einem größeren Zusammenhang aufgehoben wird und – „von guten Mächten wunderbar geborgen“ – gelegt werden kann in die Quelle des Urvertrauens, die manche Gott nennen, andere schweigend verehren, die freizulegen jedenfalls Inbegriff der Zen-Praxis ist. Und dann gibt es Leiden, das Menschen verursachen aus Aggressivität, Bosheit und Dummheit. Übermäßige Aggression mag eine Reaktion auf das Gefühl von Ohnmacht und Unsicherheit sein, das wir schon in frühester Kindheit erwerben; Bosheit als Gier und Hass mag der Versuch der Selbstbestätigung sein bzw. die Reaktion, wenn die Selbstbestätigung versagt wird – in jedem Fall wurzeln die boshaften Gedanken und Taten des Menschen in der Unwissenheit darüber, wer er selbst ist. Wer sich selbst als unfähig erlebt und für schwach oder einsam hält, wird dieses Gefühl von Mangel durch Aggression oder Autoaggression kompensieren. Solche Haltungen mutieren zu kulturellen Mustern, die dann durch Erziehung über Jahrzehnte und Jahrhunderte „vererbt“ werden, und es entsteht der Eindruck von der unabänderlichen Gewalt des Bösen.
Wer aber nicht nur intellektuell, sondern im tiefsten Grund seines Geistes „erkennt“, dass er nichts anderes ist als das konkret gewordene Leben Gottes, wer erfährt, dass er im Atem und in jeder Bewegung des Leiblichen, Seelischen und Geistigen mit allen anderen Lebewesen verbunden ist, dessen Geist tanzt in Hingabe und Liebe und Freude. Einem solchen Menschen ist Liebe kein Gebot, sondern ein spontaner Ausdruck des Lebendigseins. Wer Zen übt, bekommt davon – oft erst nach schmerzhaften Geburtswehen – eine Ahnung, manchmal auch eine überwältigende und alles verändernde Erfahrung. Damit ist das Böse aus der Welt noch nicht verschwunden, beileibe nicht. Aber es ist ein weiterer Schritt in der Evolution des Lebens, in der Entwicklung des menschlichen Geistes getan.
In tieferer Reifung Mensch werden
Es geht nicht darum, wie sich „mein“ Christentum verändert oder auch nicht. Es geht darum, wie ich in tieferer Reifung Mensch werden kann. „Christentum“ ist Gesellschaftsstruktur, die Ausprägung eines Impulses, der von der Erfahrung der Jünger mit dem auferweckten Jesus von Nazaret ausging, und der in der Geschichte sehr unterschiedliche Resonanz erfahren hat. Es gibt viele „Christentümer“, wie die Geschichte zeigt, und es werden sich noch viele entwickeln. Ob mit oder ohne Zen. Diese Geschichte enthält Größe und Niedrigkeit des Menschen, Hoffnung und Enttäuschung, Mut und Verzweiflung. Sie ist auch voller Irrtum und Gewalt. Denn Gewalt entsteht aus dem Irrtum, dass ich meine, ein bedrohtes Ich zu sein, das seine Identität gewinnen muss, indem es sich übermäßig ab- und dabei den anderen ausgrenzt. Von diesem Grundirrtum der Unwissenheit befreit zu werden, die in der falschen Wahrnehmung und Denkweise von Menschen besteht, darum geht es im Zen. Die Unwissenheit ist die Dualität, die fundamentale Trennung der Welt in Ja und Nein, in Mein und Dein, in Subjekt und Objekt und so weiter.
Dies sind unvermeidliche Denkformen, aber diese spiegeln nicht die Tiefenstruktur der Wirklichkeit. Überwindung dieses Dilemmas, das ist Christsein. Ob Zen das Christentum verändert, kann man bezweifeln. Doch Zen kann einem neuen Christsein zum Erwachen verhelfen. Und dies dürfte dann auch Auswirkungen auf das Christentum haben – dies wiederum in mannigfaltiger Gestalt.
Denkbar ist eine Gemeinschaft von Menschen, die im Geist eines erneuerten Christseins Machtansprüche ablegen. Ein „säkularisiertes Christentum“, wie es schon dem Theologen Dietrich Bonhoeffer vorschwebte, wobei wohl eher ein „spirituelles Christentum“ gemeint ist. Dies bedeutet auch eine Abrüstung von Wahrheitsansprüchen. Durch die Pluralität der Religionen und den Religionsvergleich geschieht dies ohnehin, langsam, aber unaufhaltsam. Wahrheitsansprüche werden relativiert, und das macht vielen Menschen Angst. Wenn es aber – und das ist die unmittelbare Wirkung der Zen-Praxis – nicht bei der Relativierung bleibt, sondern die Menschen erkennen, dass zwar alles relativ, dabei aber auch relational, also aufeinander bezogen ist, dann erwachen wir zu Erkenntnis. Und durch diese Erkenntnis fällt die Angst dahin – das Andere und Fremde bedroht dann nicht die eigene Identität, den eigenen Wert, sondern bereichert und erfüllt.

Eine neue Lebendigkeit
Unterschiedliche Wahrheiten müssen nicht einander ausschließende Gegensätze sein, sondern die unterschiedlichen Seiten einer Sache, die wir noch nicht kennen. Das befreit und treibt dazu an, den Weg weiter zu gehen, nicht stehen zu bleiben, sondern in Dankbarkeit für die Unerschöpflichkeit des Lebens mit Freude auf das Neue und Unbekannte das, was ich schon kenne, in einen größeren Bezug zu stellen, also in Relation zu sehen. Zen öffnet das Bewusstsein in diesem Sinne, es öffnet dafür, andere Lebensformen, auch Riten, Begriffe und neue Gestalten schätzen zu lernen, kurz: eine neue Lebendigkeit zu entwickeln. Daraus ergibt sich heitere Selbstbescheidung. Die wiederum macht Mut und erlaubt Tatkraft aus Gelassenheit – aber nichts ist absolut: offene Weite, nichts von heilig, heißt es im Zen.
Mut zum Handeln kann auch Widerstand bedeuten: gelebten Widerstand gegen die heutigen Götzen des Menschen, die da heißen Konsumgier, Machtrausch und Gewalt. Aber auch Widerstand gegen gedankenlosen Traditionalismus und Einkapselung aus Angst.
Die Übung, den Blick zu öffnen
Daraus folgt viel, und es ist ein Weg, der im Gehen entdeckt wird. Vorschnelle Allgemeinurteile und Rezepte für das Leben sind eher verdächtig. In diesem Sinne zum Abschluss eine Anekdote, die von Japan bis Indien erzählt wird. Sie geht so:
Kommt ein Missionar zu einem Zen-Meister und verwickelt ihn in ein Gespräch über Jesus. Der Zen-Meister preist die hohe moralische Qualität der Lehren Jesu. Darauf der Missionar: „Aber ist Jesus nicht ein ganz einzigartiger Mensch?“ „Ja, gewiss“, antwortet der Zen-Meister. „Meinen Sie nicht, dass man sagen muss, dass er göttlich, ja der Sohn Gottes ist?“ „Warum nicht, so kann man es durchaus ausdrücken.“ Voll Freude über seinen Erfolg verabschiedet sich der Missionar und geht. An der Straßenecke begegnet ihm Jesus. Der Missionar spricht erregt zu seinem Meister: „Herr, ich habe diesen Heiden dazu gebracht, deine Göttlichkeit zu bezeugen!“ Darauf Jesus: „Und was nützt das dir, außer dass es dein christliches Ego aufbläht?“
Christ werden, Buddhist werden
Ich habe nie den Drang verspürt, zum Buddhismus zu konvertieren. „Konvertieren“? Ja, eine Umkehr des ganzen Bewusstseins (metanoia bzw. metanoete, wie es in Markus 1,15 heißt) zum Grund des Seins. Es geht im Zen um Konversion zu dieser Tiefe, nicht um den Wechsel zu einer anderen kulturell-religiösen Lebensform, die dem Zufall geschichtlicher Wirkungen unterliegt. Zufall? Man kann es auch anders sehen. Ich bin geboren, wo ich geboren bin, aufgewachsen in einer bestimmten Sprache und Religion, erzogen von bestimmten Eltern und Lehrern. Vielleicht ist das, christlich gesprochen, der Wille Gottes? Oder, buddhistisch ausgedrückt, mein Karma? Es kommt darauf an, Christ zu werden, so wie ich vielleicht auch ein werdender Buddhist bin. Aber solche Formulierungen haben einen fast koketten Beigeschmack. Es geht darum, Mensch zu werden, und das heißt, sich zu öffnen für den unnennbaren Ursprung, aus dem alles Leben kommt, und aus dieser Kraft zu leben. Jedenfalls öffnet Zen dafür, alles als Geschenk, als neue Schöpfung, als Ausdruck der einen unbeschreiblichen Wirklichkeit anzunehmen. Zen als Geschenk, die christliche Erfahrung zu vertiefen. Und umgekehrt für die Buddhisten: der christliche Weg als Geschenk, die eigenen Oberflächlichkeiten im Spiegel zu sehen und wesentlicher zu werden. So türmt sich Geschenk auf Geschenk. Das Resultat ist Freude und Ermutigung, den Weg zu gehen. Darauf kommt es an.
Offene Weite – nichts von heilig. Genau darum, weil die Weite heilig ist. Sie ist offen, weil der menschliche Blick begrenzt ist. Nichts ist heilig, weil alles heilig ist. Der verstellte Blick ist das Unheilige, denn daraus folgen Abschließung, Eifersucht und Gewalt. Zen ist die Übung, den Blick zu öffnen.
Der Artikel ist mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag dem Buch entnommen:
Offene Weite – nichts von heilig, in: Michael Seitlinger, Jutta Höcht-Stöhr (Hg.), Wie Zen-Meditation mein Christsein verändert. Erfahrungen von Zen-Lehrern, Kevelaer: topos plus 2016, S. 33–50.


Prof. Dr. Michael von Brück
Michael von Brück, geboren 1949, ist evangelischer Pfarrer und emeritierter Professor für Religionswissenschaft in München. Er lebte viele Jahre in Indien, ist seit 1985 Zen- und Yoga-Lehrer und arbeitet mit dem Dalai Lama zusammen. ahlreiche Verö!entlichungen, darunter die Standardwerke „Zen: Geschichte und Praxis“ und „Einführung in den Buddhismus“.


