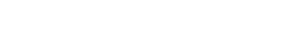Warum … auch der Buddhismus ein Problem mit rechtem Gedankengut hat
Vor etwa 15 Jahren begleitete ich Brad Warner, der damals gerade zwei Bücher über Punk und Zen geschrieben hatte, durch den Hamburger Stadtteil St. Pauli. Brad ist ein großer Fan der Beatles, also bot ich ihm das ganze Programm an historischen Orten. Wir endeten in einer Kiezkneipe, wo wir uns uns lange und intensiv über Zen und Dogen unterhielten – ein schöner Abend.
Den Menschen, den ich damals kennenlernen durfte, kann ich nur schwer in Verbindung bringen mit dem Brad Warner, der während der Präsidentschaft von Donald Trump in den sozialen Medien immer eigenwilligere politische Statements absetzte. Als die Lehrerinnen und Lehrer der Soto Zen Buddhist Association eine gemeinsame Stellungnahme zu den politischen Folgen der Politik Donald Trumps abgaben, bezeichnete er dies als „marxistische Übernahme des Buddhismus“. Viele Gruppen in den USA laden ihn seither nicht mehr ein. In den USA ist rechtsextremer Buddhismus inzwischen so deutlich wahrnehmbar, dass er sogar Gegenstand religionswissenschaftlicher Forschung geworden ist (siehe tinyurl.com/ann-gleig-alt-right-dharma).
Und hierzulande?
Es hat lange gedauert, bis sich die buddhistische Gesamtgemeinde in Deutschland dazu entschließen konnte, den von seinen Anhänger:innen als Lama verehrten dänischen Dharmalehrer Ole Nydahl, dessen Äußerungen viele als unverhohlen rassistisch empfanden, offiziell aus ihren Reihen auszuschließen. Erinnert sei auch an die unkritische Übernahme eines Artikels der Leiterin der „Neuen Akropolis (NA)“ in Deutschland in den „Buddhistischen Monatsblättern“. Die NA beurteilt der britische Historiker Nicholas Goodricke-Clarke, Spezialist für die Geschichte der modernen Esoterik, als neotheosophische Organisation, die „unverkennbar faschistischen Vorbildern nachgestaltet“ ist – so in seinem lesenswerten Buch „Im Schatten der Schwarzen Sonne“. Auch verschwörungstheoretische Ausfälle aus buddhistischer Feder gab es schon zu lesen – im Blog des eigentlich belesenen, diskussionsfreudigen, leider schon früh verstorbenen Vipassana-Anhängers Hans Gruber. Der Blog wurde zu Beginn dieses Jahres wohl durch die jetzigen Betreuer von seiner Homepage „Buddha heute“ gelöscht.
Und es gibt auch ganz aktuelle Fälle: Vor einigen Jahren wechselte ich in meinem bevorzugten Hamburger Dojo hin und wieder einige Worte mit Holger Stienen, einem Mann, der sich in buddhistischen Kontexten sichtbar engagierte. Buddhistische Zeitschriften, darunter vor längerer Zeit auch BUDDHISMUS aktuell, haben seine Aufsätze, Interviews und Buchbesprechungen veröffentlicht. Vor den letzten Regionalwahlen in Schleswig-Holstein konnten sich die Kandidat:innen der Parteien online im NDR vorstellen. Ich war sprachlos: Dieser zurückhaltende Mensch, der auf mich geradezu wie ein Musterbuddhist gewirkt hatte, war und ist nun linientreuer Vertreter der AfD. Schon kurz vorher hatte sein Kontakt zum Dojo geendet.
Nazis in buddhistischen Kreisen
Ein Blick in die weiter zurückliegende Vergangenheit zeigt, wie fragwürdig bis offen nationalsozialistisch sich buddhistische Kreise in der NS-Zeit verhielten. Überliefert ist das „Breslauer Tagebuch“ des jüdischstämmigen Breslauer Buddhisten Walter Tausk. Er schrieb es von 1933 bis 1940. Am 27. Februar 1940 findet sich darin ein kurzer Eintrag – es wird sein vorletzter bleiben: „Gleichzeitig schrieb ich nochmal an Schloss und bat, bei Herrn Fovinda dahin zu wirken, daß er mich mit Hilfe seines hohen Gönners, des Maharadscha von Sickim, zu sich holt.“ Nichts geschah, obwohl Walter Tausk Artikel für die damaligen buddhistischen Zeitschriften schrieb und enge Kontakte zu den Gemeinden in Breslau pflegte. Seine buddhistischen Freunde waren im entscheidenden Moment nicht bereit, sein Leben zu retten.
Und auch stramme Nationalsozialisten hat der Zen-Buddhismus hervorgebracht. Beispielsweise den Philosophen Eugen Herrigel (1884–1955), Autor des berühmten Bestsellers „Zen in der Kunst des Bogenschießens“. Herriegel trat 1937 in die NSDAP ein und war von 1944 bis April 1945 Rektor der Universität Erlangen. Am 20. Januar 1935 verfasste er einen sechsseitigen Bericht an einen Regierungsrat, der für Auslandsreisen deutscher Wissenschaftler zuständig war. Darin beschreibt Herriegel den Studentenpräses der Leidener Universität „als auffallend klugen Studenten … der auch Fremden gegenüber aufgeschlossen ist, (dem) es aber schwerfiel, uns in der Beurteilung der Judenfrage auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Über eine Stunde lang versuchte ich ihn darüber aufzuklären, dass uns in Deutschland keine andere Wahl mehr blieb, dass es einfach ein Akt der Notwehr war, den jüdischen Einfluss in Politik, Wirtschaft, Presse, Wissenschaft Kunst u.s.w. auszuschalten, wenn nicht jüdischer Geist uns (handschriftlich eingefügt) wie jüdische Denker selbst schon prophezeit haben vollends überwuchern sollte.“
Den Brief schließt Eugen Herriegel mit den Worten: „… gerade im Gespräch mit holländischen Gelehrten trat mir mehrfach die Wendung entgegen, das neue Deutschland sei ihnen ‚unheimlich‘. Ich glaube zu folgender Deutung berechtigt zu sein …. In dem Wort ‚unheimlich‘ kommt eine Mischung aus Angst und Bewunderung, wie vor einer unaufhaltsamen Naturgewalt, zum Vorschein: das neue Deutschland kann alles, auch das Unerwartete und Unberechenbarste – wenn es nur will.“
Warum ist das über die Person Herriegels hinaus bis heute relevant? Weil hier eine „vernunftbefreite Spontaneität“ beschworen wird, die bis heute vielen Zen-Schüler:innen aus der Literatur als Ideal zen-buddhistischer Erfahrung bekannt sein dürfte. Auch in den späteren Veröffentlichungen Herriegels, vor allem in den Darstellungen des Bogenschießens, bleibt sie ein ganz zentrales Motiv und ist ähnlich auch bei Karlfried Graf Dürckheim zu finden, von dem später noch die Rede sein wird.
NS-Propaganda-Melodram aus buddhistischer Feder
Ein zweites Beispiel: Die Künstlerin und eine Zeit lang viel gelesene buddhistische Buchautorin Gerta Ital (1904–1988) liebäugelte nach einer tiefen existentiellen Krise mit Spiritismus und Theosophie, trat dann aber 1930 in die NSDAP ein. Ab 1940 arbeitete sie als Drehbuchautorin und schrieb 1944 das Buch für den Film „Die Affäre Roedern“, ein nach dem Krieg verbotenes „Propaganda-Melodram“, wie das Deutsche Filmmuseum zu diesem Machwerk festhält.
1962 erschien ein Groschenroman mit dem Titel „Immer nur Claudia“ aus ihrer Feder, darin die für das Genre übliche Liebesgeschichte: Erfolgreicher, einsamer Mann trifft auf dynamische, blonde Frau. In einer Passage umschwirrt ein – für sie natürlich unpassender – Fotograf die Protagonistin. Dafür lässt er einen Fototermin mit einer Sängerin platzen. Stattdessen schickt er das „kleine Tipp-Fräulein“, wie die Autorin sich ausdrückt, aus seinem Büro. Auch für die Sängerin hat Gerda Ital eine Bezeichnung parat: Offen greift sie dafür zum N-Wort.
Solche Personenbeschreibungen mag man noch mit dem damaligen Zeitgeist entschuldigen können. Als die Sängerin jedoch – berechtigterweise – wütend wird und das Tipp-Fräulein „ängstlich aus dem Raum flieht“, beendet Ital die Szene mit den Worten: „Der Urwald donnerte im leeren Raum.“ Mit diesem Schlusssatz lässt sich die Darstellung nicht mehr anders als inhärent deutschtümelnd-rassistisch verstehen; die schwarze Sängerin bleibt zudem die einzig durchgehend negativ konnotierte Person im ganzen Roman.
Nicht übergehen möchte ich, dass Gerta Ital – anders als Eugen Herriegel und Karlfried Graf Dürckheim – später andeutungsweise von ihren früheren Überzeugungen abrückte. In ihrem letzten Buch, den 1977 erschienen „Meditationen aus dem Geist des Zen“, schreibt sie immerhin: „Mögen Mahnmale diese Einsicht bewirken: Was unter Hitler einer bestimmten Menschengruppe geschah, darf sich niemals wiederholen.“ Mit „einer bestimmten Menschengruppe“ meint Gerda Ital wahrscheinlich die ermordeten Juden – und bleibt offenkundig weiter unfähig, sie zu benennen.
Dürckheim – elitär und antisemitisch
Der deutsche Diplomat, Psychotherapeut und Zen-Lehrer Karlfried Graf Dürckheim (1896–1988) scheint dagegen auch in den späten Phasen seines Lebens von derlei Bedauern gar nichts gehalten zu haben; es hätte auch nicht zu seiner elitären Ideologie gepasst. So hegte er, trotz einiger Differenzen, eine große Wertschätzung für den italienischen Kulturphilosophen und Rassentheoretiker Julius Evola, der bis zu seinem Lebensende bekennender Antisemit war und als solcher von den militanten italienischen Neofaschisten der 1970er-Jahre sehr bewundert wurde. Für Julius Evola waren die Juden das „Hauptübel der modernen Welt“, wie der oben schon erwähnte Nicholas Goodrick-Clarke herausgearbeitet hat: „Metaphyisch betrachtet … glichen die Juden den Frauen. Beide hätten sie keine Seele und kein Streben nach Unsterblichkeit“, beschreibt der britische Historiker Evolas Weltbild. Karlfried Dürckheim blieb in seiner Bewunderung dennoch völlig ungebrochen. Er übernahm sogar Evolas Begrifflichkeiten: 1965 hatte der Italiener den Aufsatz „Über das Initiatische“ publiziert – Karlfried Dürckheim lässt das Wort begeistert in seine „Initiatische Therapie“ fließen.
Wie Eugen Herrigel befasste sich auch Dürckheim ab den 1920er-Jahren mit dem Theologen und Mystiker Meister Eckhart. Seine Beschäftigung mit östlichen Religionen begann mit einem von ihm als Erleuchtungserlebnis beschriebenen Moment, als er den elften Vers des Daodejing las. Er verwendet in der Beschreibung dieses Moments übrigens dieselben Worte wie Eugen Herriegel in seinem Buch über das Bogenschießen. So erkennt man beim kompakten Lesen der Bücher dieser beiden Autoren Ursprünge und Entwicklung einer Phraseologie, die vielfach heute noch unkritisch in Zen-Kreisen genutzt wird.
Nazipropaganda in Japan
Nach seinem Studium und Tätigkeiten als Psychologiedozent an verschiedenen Universitäten wechselte Dürckheim in die Dienststelle Ribbentrop, eine paradiplomatische Institution der NSDAP neben dem Außenamt. Wegen seiner jüdischen Großmutter wurde er zwischenzeitlich entlassen, aber durch Unterstützung des führenden NSDAP-Ideologen und knallharten Antisemiten Alfred Rosenberg nach Japan versetzt, wo er sich den Ruf eines linientreuen Nazis erwarb. Mit seiner Zen-Praxis war es nicht so weit her, wie er später glauben machen wollte, so jedenfalls die Einschätzung des Kunsthistorikers Dietrich Seckel, nach dem Zweiten Weltkrieg Professor und Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: „Dürckheim ging auch in die Klöster und hat dort Meditation betrieben. Aber diese Vertiefung in das zen-buddhistische Japan war zum Teil sehr übertrieben. Vor allen Dingen, wenn man sah, wie er gleichzeitig Nazipropaganda machte.“
Liest man sein Buch „Vom doppelten Ursprung des Menschen“, zeigt sich, wie Dürckheim Zen-Spiritualität und Nazi-Ideologie nahtlos miteinander verschmilzt. Im Kapitel „Zweierlei Wissen“ schreibt er zunächst: „Es gibt ein zeitbedingtes und ein überzeitliches Wissen.“ Daraus folgt für ihn die Unterscheidung zwischen dem „Übermenschen“, der weiter gefesselt sei an Welt, Ethos und Religion, und dem „Initiierten“, der im Urgrund wurzelt, wie auch Evola meinte. Beim Initiierten tritt an die Stelle der Erlösung die Erweckung und an die Stelle von Moral und menschlicher Güte der Amoralismus. Nichts zählt außer der „metaphysischen Bewusstwerdung der Transzendenzdimension im Menschen selbst“.
Um in diese Dimensionen vorzustoßen, braucht es für Dürckheim eine „initiatische Begabung“, die nur Auserwählten vorbehalten ist. Darum ist auch nur eine ritterlich-aristokratisch-spirituelle Hierarchie dem Menschen als Gesellschaftsform angemessen, meint Dürckheim und stimmt auch darin mit Evola überein. Mit dem „Initiatischen“ entwerfen diese beiden rechtsradikal-rassistischen Denker einen intellektuellen Überbau der Gegenaufklärung. Wer die unverblümte NS-Verehrung Dürckheims einmal anhören möchte, findet bei YouTube ein langes ZDF-Interview mit ihm (tinyurl.com/interview-duerckheim-youtube) und kann ab Minute 38 auch miterleben, wie der Interviewer des öffentlich-rechtlichen Fernsehens Dürckheims Hitler-Wohlwollen völlig unkommentiert stehen lässt. In den Kommentaren der YouTube-Follower findet sich dann viel Begeisterung für Karlfried Dürckheim, und in seiner Wikipedia-Biografie steht lapidar: „Durch die Ausbildung von Meditationslehrern trug Dürckheim zur Verbreitung des Zen in Deutschland bei.“
Da frage ich mich: Welches Zen?
Haben Zen und Buddhismus in Deutschland ihre politisch rechtsoffene Gegenwart – möglicherweise gehört dazu auch ein nicht unerheblicher Anteil esoterisch-querdenkerisch gestimmter Anhängerinnen und Anhänger mit rechtsoffenem Denken – genügend im Blick? Arbeiten sie ihre Vergangenheit auf? Den Eindruck habe ich leider nicht. Ich halte es für an der Zeit, beides anzugehen, denn der derzeitige Rechtsruck und ein grassierender Antisemitismus fordern deutlich eine Reflexion und Reaktion.

Eberhard Kügler
Eberhard Kügler war von 2011 bis 2022 Fachredakteur für Religionen beim NDR-Fernsehen. Er hat Religions- und Sprachwissenschaften studiert, Feldforschungen im indischen Karnataka durchgeführt und war mehrere Jahre im vertreibenden und herstellenden Buchhandel tätig. Seit seinem 16.“Lebensjahr praktiziert er Zen.