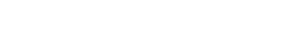Gesundheit neu denken
Zwischen Achtsamkeit, Salutogenese und gesellschaftlichem Wandel
In einer Welt, geprägt von wachsender Belastung und einem Gesundheitssystem, das oft auf Reparatur statt auf Vorsorge ausgerichtet ist, verändert sich der Blick auf Gesundheit und Heilung. Welche Rolle spielen dabei Konzepte wie Achtsamkeit, Salutogenese und Selbstmitgefühl – und was lässt sich aus der buddhistischen Perspektive lernen? Darüber spricht Sarina Hassine mit den Expertinnen für Gesundheitsförderung und Achtsamkeit Antje Miksch und Martina Aßmann.
Sarina Hassine: Welche Rolle spielt das Thema Gesundheit in eurem Alltag beruflich wie privat. Wie haltet ihr euch gesund?
Martina Aßmann: Die Verbindung zwischen Arbeit und Gesundheit ist mein Beruf. Als Ärztin, Therapeutin und MBSR1-Lehrerin unterstütze ich Menschen darin, ihre Arbeit so zu gestalten, dass sie nicht krank werden, sondern im Gegenteil gesund bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Arbeit an sich nicht krank macht – ganz im Gegenteil: Arbeit kann sogar gesundheitsförderlich sein. Entscheidend ist, dass meine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eine Weise gefordert werden, die für mich herausfordernd und angemessen ist. Dann wirkt Arbeit positiv auf meine Gesundheit. Wichtig ist, aktiv Ressourcen aufzubauen und zu stärken. Genau dabei unterstütze ich Menschen – und ich glaube, ich bin da ein gutes Vorbild: Ich fahre lieber Fahrrad, gehe oft tanzen und zum Pilates, besuche Konzerte, Lesungen und das Theater. Ich pflege einen guten Freundeskreis. Was mir allerdings schwerfällt, ist einfach mal nur dazuliegen und in die Luft zu schauen – da habe ich definitiv Nachholbedarf.
Antje Miksch: Ich habe Medizin studiert und anschließend Gesundheitswissenschaften. Damit verbinde ich einen Perspektivwechsel, weg von der Frage, was krank macht, hin zu der, was gesund erhält. Inzwischen bin ich Professorin für personenzentrierte Gesundheitsförderung an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Hier handelt es sich um eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin, die mit viel Evidenz die Bedeutung dieses Ansatzes unterstreicht. Gesundheit ist kein Selbstläufer: Die meisten Menschen wissen, was ihnen guttun würde. Die Herausforderung besteht darin, das Wissen im Alltag umzusetzen und zu verhindern, dass es ständig unter die Räder kommt. Viele kennen das Gefühl, eigentlich „mal wieder etwas tun zu müssen“, und sind dann von einem schlechten Gewissen begleitet.
Deshalb versuche ich, diese Prinzipien auch in meinem Alltag zu leben, beispielsweise, indem ich mir bewusst Zeit für Pausen nehme und diese Zeit auch einplane. Gerade im Hochschulalltag ist es für mich wichtig, mich immer wieder kurz zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen, etwa indem ich mich für fünf oder zehn Minuten in mein Büro setze, ohne etwas zu tun. Dabei ist mir wichtig, mir selbst einzugestehen, dass es nicht immer leicht ist. Wir alle stoßen auf innere und äußere Barrieren. Für mich ist neben Ernährung und Bewegung auch eine regelmäßige Meditationspraxis elementar.

Wie hat sich das Verständnis von Gesundheit und Heilung in den letzten Jahren gewandelt? Entwickelt sich gesellschaftlich ein neues Bewusstsein für diese Themen?
Antje Miksch: Es hat sich deutlich gewandelt. Die großen Themen unserer Zeit – Transformation, Nachhaltigkeit und Klimawandel – zwingen uns dazu, unser Bewusstsein für Gesundheit zu verändern und weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Meilenstein war 1986 die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation WHO. Als grundlegendes Dokument der Gesundheitsförderung hat sie Gesundheit erstmals als umfassende Ressource für das tägliche Leben definiert – und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit. Sie hat dazu beigetragen, dass sich gesundheitliche Aspekte in verschiedenen Gesetzen und gesellschaftlichen Bereichen wiederfinden. Aktuell spüren wir, dass es nicht mehr ausreicht, nur über diese Themen zu sprechen. Das Bewusstsein muss auch in konkretes Handeln umgesetzt werden.
Seit 2018 ist es ein nationales Leitziel in der Gesundheitspolitik, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken. Das Deutsche Netzwerk Gesundheitskompetenz unterstützt dabei, diese Kompetenzen als Schlüsselressourcen für eine gesunde Gesellschaft zu etablieren, und trägt dazu bei, dass der Zugang zu Gesundheitsinformationen für alle Bevölkerungsgruppen verbessert wird. Wichtig ist aber auch, nicht nur immer mehr Wissen oben draufzupacken, sondern Menschen darin zu unterstützen, Wissen zu verstehen, es anwenden zu können – und gleichzeitig eine innere Weisheit in der eigenen Lebensweise zu entwickeln, die über reines Faktenwissen hinausgeht.
Wie sieht es an den Hochschulen aus?
Antje Miksch: Gerade dort ist das Thema seit einigen Jahrzehnten präsent, bleibt aber nach wie vor ein Nischenthema. Das liegt auch daran, dass das Gesundheitssystem mit seinem traditionell krankheitsorientierten Blick eine starke Lobby hat und es daher schwerfällt, einen breiteren gesundheitsorientierten, salutogenetischen Ansatz zu etablieren. Dennoch kann Gesundheit heute nicht mehr nur ein Thema des Gesundheitssystems sein, sondern gewinnt auch in anderen Bereichen wie Bildung und Arbeitswelt an Bedeutung. Strukturen wie das betriebliche Gesundheitsmanagement oder die psychische Gefährdungsbeurteilung werden immer wichtiger und zunehmend ernst genommen. Früher haben Unternehmen abgewogen, ob sie sich Gesundheitsförderung leisten können. Heute stellt sich immer häufiger die Frage, ob sie es sich leisten können, keine zu haben.

Bewusstseinswandel und Achtsamkeit – was lässt sich dazu sagen?
Martina Aßmann: Achtsamkeit ist ein Schlüsselelement, weil sie uns hilft, aus dem Kopf in den Körper zu kommen und wirklich zu spüren, wo wir gerade sind und wie es uns geht. Dieses Innehalten und bewusste Wahrnehmen des eigenen Zustands ermöglicht es, Wissen nicht nur im Kopf zu behalten, sondern es auch im Körper zu verankern und zu integrieren. Konkret bedeutet das: Durch achtsame Körperwahrnehmung erkennen wir beispielsweise frühzeitig Anzeichen von Stress, Verspannung oder Überforderung und können gezielt gegensteuern, bevor daraus ernsthafte gesundheitliche Probleme entstehen. Achtsamkeit unterstützt uns dabei, nicht nur Symptome zu registrieren, sondern auch die eigenen Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und entsprechend zu handeln – etwa durch Pausen, Bewegung oder bewusste Entspannung. So wird Gesundheitskompetenz praktisch erfahrbar. Für mich bedeutet Achtsamkeit, bei mir selbst zu sein, mein Gegenüber wahrzunehmen und auch die Beziehung zwischen uns im Blick zu behalten – eine Haltung, die letztlich auch unsere Beziehung zur Welt prägt. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Wissen, Achtsamkeit und Beziehung sehe ich das Potenzial, Gesundheitskompetenz ganz konkret und lebendig werden zu lassen.
BUDDHISMUS TRADITIONSÜBERGREIFEND WERTSCHÄTZEN UND FÖRDERN
Als traditionsübergreifende Zeitschrift weiß sich „BUDDHISMUS aktuell“ sowohl den buddhistischen Schulen mit ihrer teils viele Jahrhunderte zurückreichenden Geschichte verpflichtet – wie auch jüngeren, westlich-buddhistischen Strömungen.
Die Deutsche Buddhistische Union (DBU) und ihre Zeitschrift „BUDDHISMUS aktuell“ sind einzigartige Projekte im deutschsprachigen Raum: traditionsübergreifend, nicht-kommerziell, allein vom Geist der gegenseitigen Wertschätzung und Großzügigkeit getragen.
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer SPENDE. Bitte mach unsere Arbeit auch zukünftig möglich mit deinem ABBONNEMENT oder Eintritt in die DBU.
Vielen Dank!
Der Ansatz der Salutogenese hat den Blick auf Gesundheit verändert. Könnt ihr das kurz erläutern?
Antje Miksch: Der Medizinsoziologe und Wissenschaftler Aaron Antonovsky war in den 1970er-Jahren der Erste, der die klassische Frage „Was macht krank?“ umdrehte und stattdessen fragte: „Was hält Menschen gesund?“ Damit löste er sich vom traditionellen Entweder-oder-Denken der Schulmedizin, die Gesundheit und Krankheit als Gegensätze betrachtet. In seinem Ansatz der Salutogenese zeigt Antonovsky, dass es vielmehr ein Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit gibt, auf dem wir uns alle – je nach Lebenssituation – unterschiedlich bewegen.
Krankheit gehört nach seinem Verständnis zum Leben dazu; entscheidend ist, wie wir damit umgehen und unsere Herausforderungen bewältigen. Zentral sind dabei die sogenannten Widerstandsressourcen und das Gefühl von Kohärenz und Stimmigkeit im eigenen Leben. Antonovsky verwendet die Metapher vom Fluss des Lebens: Es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, im Fluss zu schwimmen – unabhängig davon, wie ruhig oder turbulent er gerade ist. Dieses Verständnis baut eine Brücke zu Konzepten, wie es sie im MBSR oder Buddhismus gibt, bei denen es ebenfalls darum geht, die eigene Schwimmfähigkeit im Leben zu trainieren und mit allem, was das Leben bringt, zurechtzukommen. Daraus folgt auch eine gesellschaftliche Verantwortung: Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die es allen ermöglichen, diese Fähigkeiten zu entwickeln – etwa durch gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen oder geschützte Lebenswelten für Kinder.
Martina Aßmann: Es braucht beides, die Veränderung von Rahmenbedingungen und die Arbeit am eigenen Verhalten. Denn manchmal lassen sich äußere Bedingungen nicht ändern, dann bleibt nur die innere Haltung als Ansatzpunkt. Gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen ist der Blick häufig stark auf das Kranke verengt. Viele definieren sich über ihre Diagnose und verlieren dabei das Gesunde aus dem Blick. Salutogenese und Achtsamkeit bieten hier einen ergänzenden Ansatz, um den Blick wieder zu öffnen und neue Handlungsspielräume zu entdecken.
Wie bekannt ist das Konzept der Salutogene bei Beschäftigten im Gesundheitswesen?
Martina Aßmann: Vor Kurzem habe ich einen Achtsamkeitskurs für Ärztinnen und Ärzte begleitet. Es hatte viele Jahre gedauert, bis die Hamburger Ärztekammer bereit war, ein solches Training anzubieten, und schließlich saß ich dort mit Hausärzten, Psychiaterinnen, Arbeitsmedizinern, Radiologinnen. Alle standen unter enormem Druck und hatten sich bewusst für das Thema Resilienz und Selbstfürsorge angemeldet. Das Konzept der Salutogenese war den meisten völlig unbekannt – und die wenigsten haben es geschafft, auch nur dreiminütige Übungen in ihren Alltag einzubauen. Das hat mir noch einmal gezeigt, wie wenig diese Perspektive im ärztlichen Alltag verankert ist. Man behandelt vor allem Krankheit, aber fördert und erhält nicht Gesundheit. Ein echter Perspektivwechsel im System findet so nicht statt. Das Argument „Ich habe keine Zeit“ ist weit verbreitet – und selbst, wenn theoretisch mehr Zeit zur Verfügung stünde, würde sie vermutlich nicht automatisch für Selbstfürsorge oder Achtsamkeit genutzt werden. Es braucht also nicht nur strukturelle Veränderungen, sondern auch einen kulturellen Wandel im Umgang mit Gesundheit und Eigenverantwortung.
Wir haben den Buddhismus schon kurz angesprochen – könnt ihr die Bezüge noch genauer erläutern?
Martina Aßmann: Sowohl die Salutogenese als auch der Buddhismus unterstreichen den Wert einer positiven inneren Haltung und der Selbstregulation, um Gesundheit zu erhalten und Stress zu überwinden. Beide Ansätze zeigen, dass Wohlbefinden nicht nur durch äußere Umstände, sondern vor allem durch die innere Haltung und die Fähigkeit, mit Herausforderungen bewusst umzugehen, bestimmt wird. Im buddhistischen Daseinskreislauf, samsara, wird der immerwährende Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt beschrieben, in dem alle fühlenden Wesen gefangen sind. Dieser Kreislauf ist geprägt von Leiden, dukkha. Das rührt nicht nur aus existenziellen Fragen, sondern auch aus alltäglichen Erfahrungen von Gesundheit und Krankheit, die der Buddhismus als natürliche Bestandteile des Lebens betrachtet. Niemand ist dauerhaft gesund oder krank, sondern alles befindet sich im Wandel. Darin spiegelt sich ein zutiefst salutogenetisches Verständnis: Das Leben findet immer auf einem Kontinuum zwischen Leichtigkeit und Schwere, Schönem und Hässlichem, Genuss und Leid statt.
Ein wichtiges Konzept in der Salutogenese ist das Kohärenzgefühl.
Martina Aßmann: Ja, das Gefühl, das Leben als verständlich, handhabbar und sinnvoll zu erleben. Die buddhistische Achtsamkeitspraxis stärkt das Kohärenzgefühl, indem sie uns hilft, den Moment klar zu erleben, unsere Gedanken und Gefühle ohne Bewertung zu beobachten und so die Welt bewusster zu erfahren. Am Ende teilen beide Modelle auch das Prinzip des Gleichgewichts. Der Buddhismus spricht vom Mittleren Weg, der hilft, Extreme zu vermeiden und ein ausgewogenes Leben zu führen. In der Salutogenese geht es darum, ein Gleichgewicht zwischen den eigenen Ressourcen und den Anforderungen des Lebens zu finden, um gesund zu bleiben. Beide zeigen also, dass ein gutes Leben vor allem von der Balance abhängt – sowohl nach außen als auch nach innen.
Antje Miksch: Auch Mitgefühl und Selbstmitgefühl, die der Buddhismus betont, sind für Gesundheit und Heilung sehr wichtig. In schwierigen Momenten Freundlichkeit sich selbst gegenüber zu üben, ist essenziell für die Heilung. Regelmäßige Praktiken wie die buddhistische Metta-Meditation oder andere Selbstmitgefühlsübungen sind deshalb so wichtig, weil sie diese Haltung im Nervensystem verankern und trainieren.
Kann man sagen, Spiritualität spielt bei der Förderung von Gesundheit eine Rolle?
Antje Miksch: Das zeigen viele Studien – Spiritualität kann eine wichtige Ressource für Gesundheit sein. Viele Menschen ziehen daraus Kraft, insbesondere in unsicheren oder belastenden Zeiten. Dabei geht es nicht zwingend um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, sondern eher um den Glauben an etwas, das größer ist als das eigene Selbst – eine innere Kraft oder Verbundenheit, die trägt und hält. Diese Erfahrung kann durch Meditation, Gebet oder andere persönliche Rituale entstehen und bietet für viele eine spürbare Quelle von Resilienz und innerer Stärke. Spirituelle Ressourcen wirken wie Nährstoffe für die Gesundheit. Sie aktivieren Selbstheilungskräfte und stärken das Gefühl von Sinn und Verbundenheit.
Vielen Dank für das Gespräch!
Anmerkung
1 Mindfulness-Based Stress Reduction – Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. MBCT steht für Mindfulness-Based Cognitive Therapy.
Weitere Informationen

Antje Miksch
ist Professorin für Modern Health Science mit dem Schwerpunkt personenzentrierte Gesundheitsförderung an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Sie verbindet wissenschaftliche Lehre, Forschung und praktische Anwendung rund um Gesundheit, Resilienz und Achtsamkeit sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der von Organisationen. Zudem arbeitet sie als MBSR-Lehrerin und Coach.

Martina Aßmann
ist Fachärztin für Arbeitsmedizin mit Zusatzqualifikation in Psychotherapie und arbeitet als Kursleiterin und Ausbilderin für MBSR und MBCT. In Hamburg führt sie eine Privatpraxis, in der sie achtsamkeitsbasierte Verhaltenstherapie anbietet und Menschen in Krisen berät. Engagiert ist sie auch im Vorstand des Berufsverbands der Achtsamkeitslehrenden (MBSR/MBCT-Verband). Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen, Resilienzförderung und die Integration von Achtsamkeit in Unternehmen.