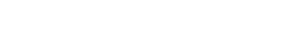„Wir haben die Pflicht zur Zuversicht“
Seit 25 Jahren lädt die Stiftung Weltethos gemeinsam mit der Universität Tübingen herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft, Religionen und öffentlichem Leben jährlich zu einer Weltethos-Rede ein. In diesem Jahr hat die Journalistin und Nahostexpertin Natalie Amiri in einer von Krisen geschüttelten Welt über den hohen Wert der Demokratie gesprochen. Wir präsentieren ihre Rede in gekürzter Form.

Vielen Dank für die Einladung und die Ehre, heute sprechen zu dürfen. Und Ihnen, liebe Gäste, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mir zuzuhören. Weltethos, das klingt so gewaltig, so anspruchsvoll und komplex, so überdimensional groß, vielleicht auch unrealistisch, unerreichbar. Doch eigentlich ist es so einfach. Es geht doch darum, wie wir miteinander leben wollen. Ich reise, durch meinen Beruf bedingt, unentwegt durch die Welt und habe dabei das Privileg, viele unterschiedliche Menschen verschiedenster Kulturen und Religionen kennenzulernen. Und wissen Sie, was sie sich alle wünschen: Sicherheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Ehrlichkeit.
Haben Sie schon mal die Bibel, den Koran und die Thora verglichen? Die moralischen Gebote dieser drei abrahamischen Religionen stimmen überwiegend überein. Doch auch außerhalb dieser Religionen verbinden uns diese Werte. Die Menschen wollen fair und freundlich behandelt werden, mit Respekt, sie wollen sich keine Sorgen machen müssen. Die wunderbare Margot Friedländer, die uns leider letzten Freitag verlassen hat, wurde nicht müde zu sagen: „Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut.“
Stille Revolution

Ich komme gerade zurück aus Syrien und ich möchte Sie heute ein wenig mitnehmen in meine Sprünge zwischen den Welten. Lassen Sie mich Ihnen von Rojava erzählen. Rojava ist die Region in Nordostsyrien, in der die Kurden 2012 eine autonome Selbstverwaltung geschaffen haben, ihren Traum. Eine politische Ordnung aus dem Geist der Autonomie, von unten aufgebaut, getragen von der Hoffnung derer, die jahrzehntelang unsichtbar waren. Es war und ist eine stille Revolution, von der wir kaum etwas mitbekommen haben. Kein Spektakel, sondern ein Versuch, aus dem Schmerz der Geschichte eine humane Zukunft zu formen.
Im Jahr 2011 zog sich das Assad-Regime teilweise aus mehrheitlich kurdischen Gebieten im Nordosten Syriens zurück, da der brutale Machthaber sich auf das Überleben seines Regimes konzentrierte. Die bisher diskriminierten Kurden nutzten das Machtvakuum und bauten das auf, was schon lange ihr Traum war: eine unabhängige, fortschriftliche Autonomiebehörde. Es war eine Revolution. Ihre Revolution.
Als ich vor zwei Wochen nach Rojava einreiste, hatte ich die Vorstellung, dass dort alles glänzt und blüht und prosperiert. Doch die Realität schlug mir in anderer Form entgegen. Als ich die Grenze vom Irak nach Rojava in Syrien passierte, fuhr ich Hunderte Kilometer durch Steppe, die Landschaft ist karg und trocken, trist, kein Baum, kein Grün, keine Farben. Als ich in die Städte kam, war alles grau, Stromkabelnetze, die über den Straßen hingen wie dreckige, staubige Spinnennetze, verhinderten teilweise die klare Sicht gen Himmel. Mehrmals am Tag fiel der Strom aus, nicht ein-, zwei- oder dreimal, sondern zwanzigmal. Es gibt auch Städte, in denen die Menschen nur über Generatoren, die sie sich selbst beschaffen müssen, Elektrizität beziehen. Und fließend Wasser, das gab es in der Stadt Hasake zum Beispiel überhaupt nicht, seit mehreren Jahren muss sie über Wassercontainer versorgt werden. Das liegt daran, dass die Türkei die Wasserzufuhr, die an der Grenze liegt, gekappt hat.

Die Welt duldet die Ungerechtigkeit
Überhaupt hat die Türkei mit der kurdischen Selbstverwaltung ein Problem. Die größte Sorge Ankaras ist, dass ein autonomes kurdisches Gebiet an der syrisch-türkischen Grenze separatistische Bestrebungen im eigenen Land anheizen könnte. Deshalb besetzt türkisches Militär Gebiete in Rojava und fliegt mit Drohnen Angriffe auf die Infrastruktur, sorgt für Tausende Binnenflüchtlinge. Die Welt duldet dies, und deshalb setzt Erdoğan seine Politik ohne Konsequenzen weiter fort. Die kurdische Selbstverwaltung ist völkerrechtlich von niemandem anerkannt, deshalb hat die Bundesregierung auch keine offiziellen Beziehungen zu ihr. Es ist der Grund auch dafür, dass Deutschland hier weder investiert noch Gerichtsurteile aus der Selbstverwaltung anerkennt. Die Kurden vermuten, dass die deutsche Regierung nicht ihren NATO-Partner Türkei verärgern will – ansonsten würde dieser dann wieder mit Flüchtlingen drohen. Wieder, wie so oft, wird auch hier politische Stabilität für uns auf Kosten von Gerechtigkeit verhandelt. Weil Menschenleben, irgendwo da draußen, leichter zu übersehen sind, als einen diplomatischen Konflikt zu riskieren. Übrigens: Die Rüstungslieferungen aus Deutschland in die Türkei sind im vergangenen Jahr mit knapp 231 Millionen Euro auf dem höchsten Stand seit 2006.
Das dröhnende Schweigen der Weltgemeinschaft
Über meinem Kopf in Rojava also das dröhnende Schweigen der Weltgemeinschaft, das laute Zischen türkischer Drohnen, die Infrastruktur und Hoffnung gleichermaßen zerstören. Vergessen die Tatsache, dass es die vor allen mutigen kurdischen Kämpferinnen waren, die an der Seite der von den USA geführten Luftallianz den Islamischen Staat bekämpften. Ich stand damals selbst für die Berichterstattung an der türkischen Grenze und sah die Terroristen mit eigenen Augen. 200 Meter vor der NATO-Grenze hissten sie ihre Flaggen des tödlichen Kalifats. Und es waren vor allem die Kurden, die Opfer brachten, 13.000 starben, um die Terroristen zu stoppen – und es gelang ihnen. Und trotzdem sind sie vergessen worden. Das ist Rojava in der Realität.
Und doch – und das ist das Unfassbare – begegnete mir in Rojava immer wieder ein Lächeln. Die Menschen dort haben fast nichts, aber sie haben einander. Sie haben ein Gefühl von Würde, das sich nicht auf Konsum gründet. Ich versuchte, zu verstehen, warum die Menschen in Rojava so viel mehr lächeln als wir. Vielleicht liegt es daran, dass sie es geschafft haben, ein demokratisches, geschlechtergerechtes und ökologisches Selbstverwaltungsprojekt als eine gesellschaftliche Alternative aufzubauen, in der Respekt und Achtsamkeit eine übergeordnete Rolle spielen, Hilfsbereitschaft. Sie sehen sich gegenseitig. Und sie sind füreinander da. Ich hatte den Eindruck, sie haben ein gemeinsames ethisches Fundament.
DENN DIE FREUDE, DIE WIR GEBEN – Großzügigkeit ist eine grundlegende buddhistische Praxis.
Die BA-Redaktion bemüht sich täglich darum, buddhistische Wortmeldungen und Texte aus allen Traditionen sowohl aus Deutschland wie weltweit wahrzunehmen, zusammenzutragen und für diese Webseiten, auf den Sozialen Medien und in der Print-Ausgabe aufzubereiten und weiterzugeben.
Unser digitales Angebot ist zu einem großen Teil kostenfrei – doch uns kostet es sehr viel Geld. Darum sind wir auf Ihre SPENDE, auf deine GROßZÜGIGKEIT angewiesen – und gerne auch auf ein ABONNEMENT, das uns wertvolle Planungssicherheit liefert.
Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.
Vielen Dank!
Menschlichkeit im Mittelpunkt
Was, wenn wir es selbst in die Hand nehmen, das Menschliche wieder in den Mittelpunkt zu stellen? Was, wenn wir nicht mehr dem Lauten, Kalten, Gierigen nacheifern, sondern dem Zarten, Achtsamen, Menschlichen? Wissen Sie, ich denke, wir haben gerade eine sehr große Aufgabe: Wir als Gesellschaft müssen durch unsere Kraft unser Miteinander, unsere so hart erkämpften Werte schützen, sie verteidigen. Deutschland ist im Moment die vielleicht wichtigste funktionierende Demokratie. Wir haben die Aufgabe, sie zu bewahren und als Vorbild zu fungieren. Doch dafür braucht es einen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb sollten wir uns erinnern, dass Demokratie nicht nur in Institutionen lebt, sondern durch das gesellschaftliche Miteinander: im Blickkontakt, im Zuhören, im Nachgeben. Was, wenn wir uns daran erinnern, dass Fortschritt nicht Sieg bedeutet, sondern Erkenntnis? Was, wenn wir begreifen, dass wahre Stärke nicht darin liegt, Recht zu behalten, sondern darin, Raum für andere zu schaffen? Wenn wir das Gute und Wertvolle auf der Welt wieder ehren und wieder für die Würde des Menschen einstehen – eines jeden einzelnen.
Was, wenn wir unseren Nachbarn einfach mal zum Essen einladen oder ein Stück Kuchen rüberbringen? Wenn wir uns nicht zuerst in den Bus drängeln, sondern anderen den Vortritt lassen? Was, wenn wir zuhören, ohne derselben Meinung zu sein? Was, wenn wir nicht am Ende unbedingt Recht haben wollen? Was, wenn das Ziel einer Auseinandersetzung nicht der Sieg ist, sondern der Fortschritt? Was, wenn wir nachgeben? Was, wenn wir lächeln?
Die Demokratie steht auf dem Spiel
Wir leben in einer Zeit, in der Demokratie, Frieden und Freiheit auf dem Spiel stehen – nicht weil sie einfach verschwinden, sondern weil wir verlernt haben, sie zu nähren, weil soziale Ungleichheit, Klimazerstörung und autoritäre Versuchungen uns betäuben. Dabei müssten wir aus unserem Glück heraus, dass wir hier geboren sind, die Verantwortung übernehmen. Wir dürfen das nicht verspielen, denn Demokratie und Menschenrechte sind nicht selbstverständlich. Unser Grundgesetz zu bejahen und eine wertebasierte Außenpolitik zu begrüßen, reicht nicht. Es braucht eine verantwortungsvolle, mutige, neue Politik.
Dafür brauchen wir wieder mehr Perspektivwechsel, Mut und Demut. Für mich sind das die Wurzeln von Veränderung zum Besseren, Gerechteren. Was, wenn wir es also einfach anders machen, als es uns gerade die meisten Machthaber auf der Welt vorleben? Was, wenn es nicht unsere Maxime ist, der Gerissenste, Aggressivste und Menschenverachtendste zu sein? Unsere Gesellschaft und unsere Werte sind es, die verantwortlich sind für den Erhalt unserer Demokratie. Sie überlebt durch Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens, nicht allein durch Gesetze.
Ein Zitat von Molière lautet: „Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ Gerade wir hier in Deutschland haben nun die große Aufgabe, zu zeigen, dass es geht, die Demokratie zu bewahren. Aber dafür müssen viele Menschen Verantwortung übernehmen. Auch ich bin entsetzt, dass viele Menschen in der Politik ihre Haltung verloren haben, von Angst getrieben, zurückrudernd zum Alten, ohne Visionen, ohne Mut. Ich sehne mich nach Politikerinnen und Politikern, deren Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit das Fundament ihres Handelns sind. Deren Wort Gewicht hat, deren Versprechen Bestand.
Aber nicht nur Politikerinnen und Politiker haben eine Verantwortung – auch wir. Wir müssen unsere Kinder zur Selbstständigkeit erziehen, es braucht Medienkompetenz an den Schulen als Fach, am besten auch noch das Fach Empathie.
Und ja, auch wir Journalistinnen und Journalisten müssen wieder mutiger sein, müssen den Journalismus vor den Medien retten. Die Medienhäuser, die früher als Hüter der Wahrheit galten, sind heute zunehmend auf Klicks und Reichweite angewiesen. Wir müssen aufhören mit diesen reißerischen Schlagzeilen, mit dem Jagen von Politikerinnen und Politikern, um nach Fehlern zu suchen, bevor sie überhaupt angefangen haben zu arbeiten. Geschichten werden vereinfacht und emotionalisiert, um Aufmerksamkeit zu generieren. Algorithmen entscheiden, welche Nachrichten viral gehen, und fördern oft extreme Inhalte.
Und weil ich von Verantwortung spreche, möchte ich auch das Völkerrecht ansprechen, die zunehmende Missachtung internationaler Normen und Regeln. Autoritäre Regierungen nutzen Menschenrechtsrhetorik selektiv, um eigene Interessen zu rechtfertigen, während sie gleichzeitig freie Presse, Justiz und Opposition unterdrücken. Weltweit geraten NGOs, Journalist:innen und Aktivist:innen unter Druck – durch Repression, Überwachung, „Foreign Agent“-Gesetze oder Internetzensur. Institutionen wie der UN-Menschenrechtsrat oder der Internationale Strafgerichtshof stehen unter politischem Druck und verlieren an Einfluss, weil Großmächte ihre Entscheidungen ignorieren oder gezielt blockieren.

Unterdrückten eine Stimme geben
Auch Deutschland muss der Vorwurf gemacht werden, mit zweierlei Maß und doppelten Standards zu agieren. Gerade bei meinen Reisen durch den Nahen und Mittleren Osten begegne ich nur noch Trümmern der moralischen Glaubwürdigkeit Deutschlands. Wir können nicht Russlands Diktator Wladimir Putin Kriegsverbrechen vorwerfen, aber die völkerrechtswidrigen Verbrechen in Gaza und im Westjordanland des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu und seiner rechtsextremen Koalitionspartner mit Waffenlieferungen belohnen. Unsere Demokratie lebt von Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und internationaler Ordnung. Doch diese Werte sind in Gefahr, wenn sie nicht konsequent verteidigt werden.
Und deshalb stehe ich heute hier und werde nicht müde, zu erzählen, warum ich die Demokratie trotz all ihrer Schwächen liebe und schätze und warum ich demütig bin, dass ich in einer lebe. Wissen Sie, warum mir das so radikal bewusst ist? Weil ich jahrelang als Journalistin in Ländern gearbeitet habe, in denen keine Demokratie herrschte. Je länger ich in Ländern wie dem Iran, Afghanistan, der Türkei, Ägypten, Eritrea, Syrien gearbeitet habe, desto bewusster wurde mir, was Freiheit, Rechtstaatlichkeit und Frieden in der Realität bedeuten. Und wissen Sie, wieso ich gerade über die iranischen Frauen und den Kampf der iranischen Bevölkerung für Demokratie wieder und wieder spreche? Weil ihre Geschichten zutiefst inspirierend sind und erden. Die Menschen im Iran erinnern mich täglich daran, wie wertvoll unsere Freiheit ist. Das sollte uns in einer Zeit, in der wir Demokratie oft als selbstverständlich ansehen, dankbar machen.
Trotz all dem, was ich heute gesagt habe, haben wir die Pflicht zur Zuversicht. Nur so kann ich selbst weiterarbeiten und wieder und wieder aus der Welt berichten über die Verletzung von Menschenrechten und denjenigen eine Stimme geben, die keine haben. Mit der Zuversicht, dass sich etwas ändert.
Ich möchte am Ende meiner Rede noch einmal auf die kluge Margot Friedländer verweisen: Sie hat gesagt: „Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet. Seid Menschen, seid vernünftig.“
Weitere Informationen
weltethos.org
Weltethosrede anhören: youtube.com/watch?v=81iEBIsEy6Y

Natalie Amiri
geboren 1978 in München, ist eine deutschiranische Journalistin und Buchautorin. Sie moderiert den Weltspiegel, das politische Auslandsmagazin der ARD aus München und das Europamagazin euroblick des Bayerischen Rundfunks. Von 2015 bis 2020 leitete sie das ARD-Studio in Teheran und arbeitet heute in Vertretung für das ARD-Studio in Tel Aviv. Für ihre regelmäßigen Berichte aus Krisengebieten ist die Nahostexpertin mehrfach ausgezeichnet worden.