Was ist eine buddhistische Identität? Plädoyer für eine Hinwendung zur Praxis
Für die Religionsgemeinschaften verspricht eine staatliche Anerkennung eine Aussicht auf Verbesserung der gesellschaftlichen Position und ihres Ansehens, möglicherweise die Erlangung eines Status, der mit dem der großen christlichen Kirchen vergleichbar ist. Damit entsteht für die Religionsgemeinschaften die Aufgabe, sich selbst zu definieren, um bezeichnen zu können, wer und was für sie repräsentativ sein soll. Das birgt Gefahren – gerade für den Buddhismus, der „anatman“ lehrt – es gibt kein beständiges Selbst.

Ein Plädoyer ist wesensmäßig parteiisch. Die folgenden Überlegungen sind auch so gemeint und erheben in keiner Weise Anspruch auf eine ausgewogene Sicht der vielfältigen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Bemühungen um ein gedeihliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Ansichten, Kulturen und Religionen.
Um ein solches Zusammenleben zu befördern, sind von staatlicher Seite mit manchen Religionsgemeinschaften Vereinbarungen zur gegenseitigen Anerkennung auf den Weg gebracht worden. Den staatlichen Instanzen geht es um die Regelung des gesellschaftlichen Lebens. Die Anerkennung einer Religion steht ihnen nicht zu. Konsequenterweise fordern sie die Angehörigen von Religionsgemeinschaften auf, repräsentative Ansprechpartner vorzuschlagen. Dem Staat geht es um Verlässlichkeit des Gesprächspartners, um die Erhaltung des inneren Friedens. Für die Religionsgemeinschaften verspricht eine staatliche Anerkennung sie vertretender Instanzen eine Aussicht auf Verbesserung der gesellschaftlichen Position und ihres Ansehens, möglicherweise die Erlangung eines Status, der mit dem der großen christlichen Kirchen vergleichbar ist. Es geht also auch um Vorteile, die über das bloße Recht auf Ausübung der Religion hinausgehen, die ja hierzulande schon durch das Grundgesetz garantiert ist. Damit entsteht für die Religionsgemeinschaften die Aufgabe, sich selbst zu definieren, um bezeichnen zu können, wer und was für sie repräsentativ sein soll. Für die althergebrachten christlichen Bekenntnisse ist dies Teil des hiesigen religiösen und kulturellen Erbes. (Das Übergehen der jüdischen Tradition hat lange Zeit zu den abgründigen Aspekten der europäischen Tradition gehört.)

Im Sog der politischen Gemengelage
Wo ein repräsentatives Gremium erst neu gebildet wird, um einen Ansprechpartner für staatliche Behörden zu schaffen, ist es kaum vermeidbar, dass dieses zu einer Instanz wird, wie sie die zu vertretende Tradition bisher nicht kannte. Konstellationen können entstehen, die Gruppierungen ein Gewicht verleihen, das mehr der politischen Gemengelage als der Bedeutung innerhalb einer Tradition entspricht. Damit wird Religion unversehens zu einer Kategorie, die zu anders nicht so leicht erhältlichem gesellschaftlichen Ansehen verhelfen kann. Ganz abgesehen davon, dass in Zeiten einer „flüchtigen Moderne“ (so charakterisiert der große polnische Soziologe Zygmunt Bauman unsere Gesellschaft, in der verbindliche gesellschaftliche Beziehungen kurzfristig eingegangen und aufgekündigt werden) die Zugehörigkeit zu einer möglichst auch sichtbaren „community” Abhilfe hinsichtlich der zunehmenden Unsicherheit und Vereinzelung zu versprechen scheint.
Wahrheitsanspruch mit hegemonialen Tendenzen
Mit der Präsenz Angehöriger anderer Religionen hierzulande und der Hinwendung mancher EuropäerInnen zu diesen, bisher „fremden” Traditionen, wie etwa dem Buddhismus, entsteht eine neue Dynamik der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Nicht unähnlich den Vorgängen bei der Ausbreitung des Christentums in der antiken Welt, in deren Verlauf der Begriff Religion eine andere Bedeutung erlangte, als sie zuvor in der Antike gängig war. Dabei spielten die Bestrebungen nach Abgrenzung, Identitätsfindung und Ausgrenzung auf eine Weise ineinander, die weitreichende Folgen in der europäischen Geschichte zeitigten. Bedeutete „religio“ zunächst bestimmte Praktiken, Kulthandlungen, begann es allmählich eine Zugehörigkeit zu bezeichnen, verbunden mit einem Wahrheitsanspruch mit hegemonialen Tendenzen. Auch damals waren es staatliche Instanzen – insbesondere Kaiser Theodosius –, die auf ein „Bekenntnis” drängten. Inzwischen gebrauchen wir Religion und Bekenntnis („Konfession”) beinahe gleichbedeutend. Und BuddhistInnen haben hierzulande auch ein „Bekenntnis” formuliert. Um „auf Augenhöhe” mitreden zu können?
Auf das gewaltträchtige Potenzial der Definition einer „Identität”, die auf Homogenität – Reinheit und Eindeutigkeit – abzielt, hat schon der indische Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen hingewiesen (1); vom Konfliktpotenzial, das bei der Definition von kulturellen Entitäten entstehen kann, weiß der Forscher und Pädagoge Frank-Olaf Radtke (2) zu berichten, nach entsprechenden Erfahrungen im interkulturellen Dialog. Er warnt eindringlich vor der dabei entstehenden Ethnisierung von Konflikten. Was als Dialog zur Erreichung von Gleichberechtigung und Toleranz gemeint war, fixiert dann Abgrenzungen, die Definition eines „Ansprechpartners“ fördert die Bildung von Fraktionen, es eröffnet sich ein Raum für Konkurrenz, Fronten entstehen.

Praxis statt Bekenntnis
In der Besinnung auf die genuinen Traditionen des Buddhismus ist, meine ich, ein Potenzial zu entwickeln, das in eine ganz andere Richtung zu wirken vermöchte. Wo identitäre Diskurse essentialistisch zu werden drohen, sind die Einsichten und Lehren des Buddhismus hinsichtlich der Zusammengesetztheit (skandha) individuellen Daseins und Bewusstseins, das Fehlen einer zugrunde liegenden Substanz, eines beständigen Selbst (anatman) geeignet, der Tendenz entgegenzuwirken, sich den Täuschungen des Wunsches nach Garanten von Dauer hinzugeben.
In der politischen Auseinandersetzung kann ein „strategischer Essentialismus“ – das Behaupten eines „Wesens“, einer festgefügten Identität – zuweilen geboten erscheinen, doch bemerkte schon die indische Denkerin und Kämpferin für Menschen- und Frauenrechte Gayatri Chakravorty Spivak, die diesen Begriff geprägt hat, dass das Bewusstsein der Strategie im Laufe der politischen Aktion leicht verloren geht.
Statt eines Bekenntnisses zu einem Wahrheitssystem plädiere ich für ein Bekenntnis zur Praxis des Achtfachen Pfads, dem Weg der Mitte, der die vermeintliche Sicherheit festgelegter Positionen überwindet. Denn Praxis bedeutet ständige Auseinandersetzung, bei der auch deutlich wird, dass Identität, wie Herkunft und Tradition, immer „zusammengesetzt“, hybrid ist. Davon zeugt auch die Geschichte des Buddhismus, wenn er sich vom gewohnten Umfeld löste und in anderen soziokulturellen Zusammenhängen bewährte – etwa in China –, was Vertiefung und Neuansatz erforderte.
„Eigen“ und „fremd“ vermischt sich in der Praxis
Es ist, meiner Ansicht und Erfahrung nach, nicht möglich herauszufiltern, was „eigen“ und „fremd“ ist, es vermischt sich in der Praxis. So wie wir alle durch unser Leben erst zu dem werden, was wir „sind“. Wer sich einer Praxis zuwendet, sie zur eigenen macht, sieht sich nicht nur veranlasst, sich mit deren Tradition auseinanderzusetzen, sondern auch mit der eigenen Herkunft und Geschichte, in deren Zusammenhang es zu dieser Begegnung kam.
Nicht selten geschieht es, dass Menschen mit der Ausübung einer meditativen Praxis des Buddhismus einen neuen Zugang zu den Inhalten der Traditionen gewinnen, in denen sie aufgewachsen sind, unabhängig davon, ob sie sich von ihnen abgewandt haben oder sich ihnen weiterhin zugehörig fühlen.
Dieses belebende, erneuernde Potenzial gilt es zu fördern, meine ich, und nicht eine weitere „Religion“ auf dem „Supermarkt der Religionen“ (wie der protestantische Theologe und Forscher Friedrich Wilhelm Graf Auswirkungen der Globalisierung charakterisiert) zu positionieren.
Oder auf eines der wesentlichen sila bezogen: Das Gebot, sich nicht zu berauschen, dürfte auch im Wettlauf nach Anerkennung daran erinnern, eine Geistesverfassung zu pflegen, die geeignet ist, den Blick für die gegenwärtige Situation zu klären und verantwortlich zu handeln. Wie anders sollte es möglich sein, ein Zusammenleben in Solidarität zu entwickeln, über alle Unterschiede hinaus und jenseits von guten Absichten, die allzu leicht zu instrumentalisieren sind?
ANMERKUNGEN:
- Amartya Sen: Identity and violence. The illusion of destiny, New York 2006
- Frank-Olaf Radtke: Kulturen sprechen nicht. Die Politik grenzüberschreitender Dialoge, Hamburg 2011
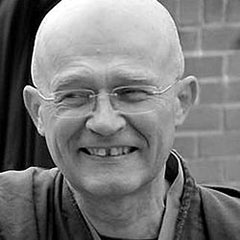
Bertrand Schütz
Bertrand Schütz, Schüler von Philippe Coupey Reiryu, begann 1978, mit Meister Deshimaru Zazen zu üben. Er arbeitete an der Übertragung von Deshimarus Unterweisung ins Deutsche, war Leiter des Zen Dojo Hamburg und gründete das Dojo in Flensburg. Inzwischen lebt er in Ludwigslust (Mecklenburg) und ist verantwortlich für das dortige Dojo.


